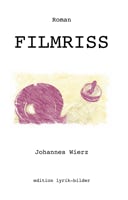offizielle Webseite
Ro
mane
Aktuell
GOETZ
Um endlich einen Schlussstrich unter seine gescheiterte Beziehung zu ziehen, entschließt sich der Erzähler Ordnung in sein Leben zu bringen. Er räumt auf und schafft alles, was ihn an die Vergangenheit erinnert, aus der Wohnung. Dabei stößt er auf einen großen ungeöffneten Umschlag, den ihm ein schwieriger und unangenehmer Zeitgenosse, Goetz, vor zehn Jahren mit den Worten: Wenn ich denn mal tot bin“, überreicht hat. Neben einem Manuskript aus unlesbaren Hieroglyphen fällt ihm ein Schlüssel in die Hände mit dem er nichts anzufangen weiß.Um so mehr er sich in der Stadt auf die Suche begibt und sich nach Goetz erkundigt, desto lauter wird ein Gerücht um eine vollautomatische Cannabisplantage, die Goetz vor seinem Tod angelegt haben soll. So wird die Suche nach dem passenden Schloss für den Erzähler immer beschwerlicher und gefährlicher. Denn mit seiner Fragerei weckt er so manche Kiezgröße aus vergangener Zeit. Dass dabei Goetz als Untoter immer wieder auftaucht, macht die Sache nicht leichter.
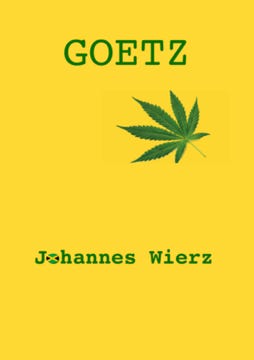
Ab Dezember 2025
TRACHT
Casablanca, den 24.07.1999
Meine Schöne,
wie Du siehst, bin ich doch gefahren. Ich habe lange auf dem Flughafen auf Dich gewartet. Erst als man mich zum dritten Mal aufgerufen hat, bin ich durchs Check-in.
Aber wie hättest Du auch kommen können? Du hast es ja nicht einmal gewusst. Sicher, Dein Instinkt hätte es Dir sagen müssen, hätte es wissen müssen, dass ich es ernst meine. Aber das große Aquarium mit den ausdruckslosen Gesichtern der Fische hat auch Dich längst verzaubert. Es hat mehr als genug Tage gegeben, da habe ich verzweifelt nach Luft geschnappt. Aber mutieren, so wie all die anderen wollte ich nicht.
Meine Schöne, Du bist immer noch in mir!
Selbst im Flugzeug, nachdem mir die Stewardess den ersten Drink gebracht hatte, den ich in einem Zug leer trank, um danach die Augen zu schließen, sah ich Dich vor mir.
Es ist der weiße französische BH, den Du trägst, der mich fast wahnsinnig werden lässt. Meine Hände strecken sich nach Dir aus, aber sie erreichen Dich nicht. Du lachst. Ich presse so fest die Augen zusammen, bis Du selbst vorne den kleinen Verschluss öffnest und das bisschen Stoff wie eine zweite Haut abstreifst. Keinen Millimeter bewegen sich Deine Brüste, sie starren mich nur fragend an.
Warum?
Warum? Manchmal ist das Schöne einfach nicht zu ertragen.
Ich öffnete die Augen und zündete mir eine Zigarette an. Dann winkte ich die Stewardess an meinen Platz. Ich zeigte auf meinen leeren Plastikbecher. Für einen Moment verlor die Frau ihr berufsmäßiges Lächeln, als wollte sie mir sagen, trinken Sie nicht so viel, der Flug ist noch lang. Aber sie sagte nichts, drehte sich um und brachte mir einen neuen Drink.
Du hast ja auch nie viel geredet. Immer war ich es, der das Wort ergriffen hat.
Hinterher war ich oft wütend auf mein endloses Geschwätz. Viel lieber hätte ich Dich küssen wollen, aber es ist schwer, die Stille zu ertragen.
Jeden Tag ziehe ich durch die Straßen der Stadt und suche nach dem Wahrzeichen, dem großen Leuchtturm. Aber wie ich mich kenne, werde ich ihn ebenso wenig zu Gesicht bekommen, wie seinerzeit den Eiffelturm in Paris.
Nachts treibe ich mich in Bars herum. Ich habe viele Huren kennengelernt, obwohl offiziell in diesem Land Prostitution verboten ist. Die Frauen sind alle auf ihre Art schön. Sie sind freundlich zu mir. Ich bezahle sie, damit sie mir Gesellschaft leisten, schlafe aber nicht mit ihnen. Ich gebe ihnen Drinks aus und erzähle ihnen von Dir. Sie verstehen kein Wort von dem, was ich sage, aber ich glaube, sie ahnen, was mich treibt.
Den Schreibblock, den ich mir auf dem Flughafen gekauft habe, trage ich immer bei mir. Die Zuhälter und Messerstecher haben davor Respekt. Sie halten mich für einen verrückten Europäer, hoffen aber in ihrer Eitelkeit darauf, dass ich einen Roman schreibe, in dem sie vorkommen, um sie unsterblich zu machen.
In Casablanca ist nichts so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Stadt hat ein europäisches Gesicht bekommen. Du weißt schon, die Fratze des Geldes. Verzeih, so etwas willst Du ja nicht hören. Genieße den Augenblick, hast Du immer gesagt. Ich kann aber nicht andauernd die Augen schließen, nur um Deinen weißen französischen
BH sehen zu wollen.
Ich werde nicht mehr lange hier in dieser Stadt bleiben. Immer öfters stehe ich vor den Schaufenstern der Reisebüros und starre auf die weißen großen Ozeandampfer, die in der strahlenden Sonne glitzern. Einmal mit dem Schiff in Triest ankommen, wie oft habe ich davon geträumt. Wie oft habe ich die Stadt Triest vor meinen Augen gesehen, obwohl ich noch nie da gewesen bin. Es ist gut, wieder in Bewegung zu sein.
Ich umarme Dich
Dein Karl
1.
Ohne es sich noch einmal durchzulesen, steckte Karl das Geschriebene in einen Umschlag. Er wusste genau, würde er es lesen, hätte der Brief keine Chance, den Weg nach Deutschland zu finden.
In der Bar des Hotels mit dem Namen Paris, das auch schon bessere Zeiten gesehen hatte und in dem die Schattenwelt, so schien es ihm, dem ahnungslosen Europäer, ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte, war noch ein zweiter Brief entstanden, den er wie den ersten in einen Umschlag gesteckt hatte.
Karl schrieb die Adresse auf den zweiten Brief, dabei lachten die beiden farbigen Nutten, die sich an seinen Tisch gesetzt hatten.
Sechs Jahre lang war diese Adresse sein Absender gewesen. Es war das erste Mal, dass er nach Hause schrieb. Als seine Gedanken das Wort Zuhause umkreisten, hasste er sich für einen Moment. Erst als seine Zunge die Gummierung des zweiten Umschlags befeuchtete, kehrte eine Ruhe in ihm ein, die ihn dazu veranlasste, eine zweite Flasche Whisky zu bestellen, worauf die beiden farbigen Nutten ihm synchron über seine Oberschenkel fuhren.
Selbst der Kellner, der ihm die zweite Flasche Whisky an den Tisch brachte, kannte seinen Namen. Seit nun mehr als fünf Tagen und Nächten frequentierte Karl, immer mit einem Schreibblock bewaffnet, diese Bar. Schon auf die erste Frage des Barkeepers hatte er seinen Namen preisgegeben. Aber mit dem Namen Karl konnte niemand etwas anfangen.
Der Barkeeper war der erste, der ihn mit Carlos ansprach. Carlos, der verrückte Europäer mit dem Schreibblock, der Nutten auf einen Drink einlud, ihnen Geld gab, ohne mit ihnen auf das Zimmer zu gehen. Mit Bestimmtheit hätte er es nicht überlebt. Neben den Zuhältern warteten die Messerstecher nur darauf. Ehe sich eine der farbigen Nutten sich ihrer Kleider entledigt hätte, wäre an Karl die lautlose Kunst des Tötens praktiziert worden.
Die europäischen Touristen starben immer mit dem Ausdruck der Verwunderung auf ihren Gesichtern. Ja, das mochten die Zuhälter, brachte die Nutten zum Lachen. Nur die Messerstecher, denen immer wieder Lob und Anerkennung für ihr lautloses Töten gezollt wurde, waren ein wenig enttäuscht. Wie gern hätten sie dem in Verwunderung erstarrtem Europäer ein Ohr als Trophäe abgeschnitten.
Ein heruntergekommener Spieler mit ein paar geklauten Dollars in seiner Tasche kam an seinen Tisch und zeigte auf Karls Ehering an der rechten Hand. Dann mischte er kunstvoll die Karten und lachte breit. Karl sah nur ein blutendes Gebiss, das Lücken aufwies. Allein drei Goldzähne hatte er letzte Nacht verloren, jetzt brauchte er ein Erfolgserlebnis. Würde der verrückte Europäer gewinnen, hätte er keine Skrupel, ihm sofort sein kleines scharfes Silberfischlein, das er in seinem Ärmel versteckt hielt, ins Herz zu stoßen.
Unaufgefordert setzte sich der Spieler an den Tisch. Die beiden farbigen Nutten rückten respektvoll zur Seite. Während Karl seine Hand betrachtete, auf die der Spieler gezeigt hatte, mischte dieser die Karten. Ihm war klar, dass
er verlieren würde, verlieren musste.
Manche der Dollarnoten, die der Spieler auf den Tisch legte, zeigten Einschusslöcher oder waren blutbefleckt. Jetzt hatte Karl seinen Einsatz zu geben. Er steckte die beiden Briefe in sein, erst hier in Casablanca gekauftes Leinensakko, und begann, seinen goldenen Ehering abzustreifen. Mit jeder Drehung rieb sich der eingravierte Name und das dazugehörige Datum in die Haut des Fingers und drang so in seinen Körper ein. Ohne sich dagegen wehren zu können, waren da wieder die alten, vertrauten Bilder.
Als erste tauchte Marion auf, seine Frau, mit der er seit sechs Jahren verheiratet war. Für einen Moment sah er ganz genau den Abend vor sich, als Marion ihn das erste Mal in ihre Wohnung mitgenommen und ihm, dem hungrigen, Erwartungsvollen, ihr Fotoalbum gezeigt hatte. Marions Siegerlächeln war Karl sofort aufgefallen. Als er aber die Bilder sah, die Chronologie ihres bisherigen Lebens, überfiel ihn ein kalter Schauer, den er sich damals nicht hatte erklären können. Marion als Baby, als Sechsjährige mit der Schultüte in der Hand, die erste Klassenfahrt, das Abschlussbild der Abiturklasse. All diese Fotos wurden von Marions Siegerlächeln beherrscht. Es war kein arrogantes Lächeln, eher das eines Menschen, der in die Zukunft schauen konnte und daher genau wusste, was er wollte. Marions Zielstrebigkeit wurde begleitet von einer Leichtigkeit. Jede noch so hohe Hürde unlösbar scheinende Schwierigkeiten überwand sie mit einer spielerisch, manchmal sogar naiv anmutenden Art, die bei den meisten Menschen in ihrer Umgebung Bewunderung hervorrief. Überall war sie die beste gewesen in der Schule während ihres Medizinstudiums,
aber niemand war ihr deswegen böse oder neidete ihr irgendetwas.
Als Karl sie kennenlernte, hatte sie gerade als Jüngste ihr Medizinstudium beendet. Damals war er vor allem von ihren Augen fasziniert, die konnten Blicken standhalten. Er war der erste, der zu Boden blickte und sich nervös eine Zigarette anzünden musste. Auch brauchte er mehrere Biere, um in Fahrt zu kommen. Sie hingegen trank Mineralwasser und hörte ihm zu. Karl hielt sich damals für den geborenen Pechvogel. Er war der felsenfesten Überzeugung, selbst wenn nur noch zwei Lose in der Trommel wären und eines davon der Hauptgewinn, so würde er mit Bestimmtheit die Niete ziehen.
Seine Kindheit hatte er auf dem Land verlebt, weit ab von den Städten. Der Tagesablauf wurde hauptsächlich von der Natur bestimmt, ihr hatte man sich anzupassen. Als man ihn dann mit zehn Jahren in ein Internat steckte, einer der schrecklichsten Momente in seinem Leben, brach für ihn eine Welt zusammen. Nächtelang weinte er leise im großen Schlafsaal in sein Kissen. Am Tag war er der kleine, schmächtige blonde Junge, der keinen an sich heranließ. Einmal während einer Lateinklassenarbeit, als ihn wieder dieses unbändige Heimweh befiel, holte er aus seinem Lederranzen das große scharfe Fahrtenmesser mit Hirschhornknauf, ein Geschenk des Großvaters, und schnitt sich bis auf den Knochen in den Ringfinger der rechten Hand. Wie ein Lauffeuer ging diese Heldentat in der Schule herum und brachte ihm Nachsitzen an vier Nachmittagen ein. Die Schulleitung zeugte ihm damit Respekt, etwas, was er damals nicht verstand, genauso wie die Angst des
Lehrkörpers vor einer Wiederholung. Denn Helden konnte man in der Schule nicht gebrauchen, schon gar nicht, wenn sie so klein und schmächtig waren wie er.
Wie viel Zeit war vergangen?
Karl kam es wie eine Ewigkeit vor. Ein paar Millimeter hatte sich der Ehering nach vorn bewegt.
Den Spieler mit den blutenden Zahnlücken, der ihm gegenüber saß, schienen seine Bemühungen, den Ring vom Finger zu bekommen, nicht im Geringsten zu irritieren. Seelenruhig mischte er die Karten und zeigte ein paar Tricks. Auch die beiden farbigen Nutten schienen guter Dinge. Karl drehte weiter an dem Ring und spürte mit einem Mal die alte Narbe.
Marions erotische Anziehungskraft bestand für Karl darin, dass sie für die Außenwelt keine zu haben schien. Niemand konnte sich Marion mit einem Mann vorstellen. Sicher, sie hatte viele Freunde und Bekannte, aber Leidenschaft oder gar Liebe, das passte nicht zu ihr. Nach ihrer Promotion arbeitete sie im Kinderkrankenhaus der Stadt. Ob Tag oder Nacht, Karl hatte immer Zeit für sie. Was Marion nicht wusste, war, dass Karl alle anderen Aktivitäten und Interessen von heute auf morgen beiseitegelegt hatte, um sich ganz auf sie zu konzentrieren. Er vernachlässigte sein Studium und kündigte auch irgendwann seinen Aushilfsjob. Wochen waren verstrichen, und er hatte es noch nicht einmal geschafft, dass sie ihre Hand in die seine gelegt hatte.
Vielleicht sollte ich einen Brief schreiben, dachte Karl eines Nachts, hellwach auf dem Bett liegend, eine Zigarette rauchend. Im Briefeschreiben hatte er Übung. Als Kind hatte er dem Großvater jede Woche aus dem Internat geschrieben,
später war der Adressat seine erste große Liebe, ein Mädchen, wie er aus demselben Dorf stammend, mit der er all seine Ferien verbrachte. Jedem Brief an sie hatte er ein selbstverfasstes Gedicht beigelegt. Als er glaubte, keine neuen Worte für seine Gefühle finden zu können, begann er damit, kleine Geschichten zu schreiben.
Die ganze Nacht saß Karl am Schreibtisch, aber es gelang ihm nicht, einen Brief an Marion zu verfassen. Es dämmerte schon, als Karl damit begann, eine Geschichte zu entwickeln. Am Nachmittag, als Marion bei ihm anrief und er von seinem Schreibtisch aufschreckte, weil er eingeschlafen war, umfasste die Geschichte zwanzig Seiten. Jede davon bestand aus ungefähr vier Zeilen, die auf der unteren Blatthälfte festgehalten waren. Die Geschichte von Alfons dem Glühwürmchen war entstanden.
Für die Kinderärztin ein Kinderbuch, hatte sich Karl gedacht, es fehlten nur noch die Bilder. Diese zwanzig Seiten, jeweils mit vier handgeschriebenen Zeilen, änderten die Beziehung der beiden schlagartig. Mit einem Kuss wurde er entlohnt, und es dauerte nicht lange, da konnten beide nicht mehr voneinander lassen.
Karl fiel es schwer, sich an die erste Nacht zu erinnern. Zu viele Dinge passierten in dieser Zeit gleichzeitig. Marion, schon nach dem ersten Lesen von der Qualität der Geschichte überzeugt, nahm wie selbstverständlich den weiteren Verlauf in die Hand. Es dauerte nicht lange, da hielt Karl die Druckfahnen seines ersten Kinderbuches in den Händen. Kurz darauf machte Karl Marion einen Heiratsantrag. Marion schaute ihn mit einem Siegerlächeln an und sagte ja.
Erst Jahre später, bei der zufälligen Betrachtung seines Hochzeitsfotos, fiel ihm auf, wie fremd er auf dem Bild wirkte, so als ob er nicht dazugehören würde. Ein guter alter Freund der Familie, das vielleicht ja, aber niemals der Bräutigam.
Karl erinnerte sich jetzt an den tiefen Schmerz, den ihm seine Narbe verursacht hatte, als Marion ihm den Ring überstreifte. Für einen Bruchteil von Sekunden sah er, wie das Blut aus seinem Finger spritzte und Marions hellblaues Hochzeitskleid sich dunkel verfärbte. Verrat, Verrat klang aus den Bergen, als Karl und Marion das alte Rathaus verließen, um auf der Freitreppe für den Fotografen in Position zu gehen. Der Wunsch des Großvaters, endlich eine österreichische Linie aufleben zu lassen, war mit der Heirat dahin. Im übrigen lag dieser schon seit über vielen Jahren auf dem kleinen Bergfriedhof im Schatten der Wehrkirche mit der Uhr ohne Zeiger.
Karl wurde für sein Erstlingswerk Alfons das Glühwürmchen mit Kinderbuch-Preisen überhäuft. Ein zweites Buch folgte mit dem Titel Die Abenteuer des kleinen Waschbären Niko und verkaufte sich dank des großen Erfolges seines Erstlingswerkes wie von selbst. In dieser Zeit entschied sich Marion zur Selbständigkeit. Kredite wurden aufgenommen, ein Haus gesucht, in dem unten die Kinderarztpraxis und oben die Wohnung eingerichtet werden sollten. Schon während des Umzugs, als Marion ihre neuen technischen Geräte aus Kartons und Plastikfolie befreite und oben Karl seine Bilderbücher, beide mittlerweile in über fünfzehn Sprachen übersetzt, in die Regale räumte, spürte er,
dass er in diesem Haus keine einzige Zeile schreiben würde. Gerade jetzt, wo er finanziell abgesichert war, der Verlag von ihm ein drittes Buch erwartete und ihm so viele Ideen im Kopf herumschwirrten, empfand er das Haus, diesen neuen Anfang, nämlich aus einem Provisorium eine Institution zu machen, als äußerst bedrückend. Da er aber für seinen inneren Zustand keine Worte fand, schwieg er und überließ sich der Zeit.
Karl legte seinen Ehering auf den Haufen der zerknitterten Dollarnoten. Er sah das Blut, aber für ihn waren das nur dunkle Flecken.
Siehst Du Marion, so einfach ist das, dachte er bei sich.
Als er das Blatt aufnahm, um die Spielkarten zu studieren, zwickte ihn seine Narbe so sehr, dass er seine Hand reflexartig in die weiße Leinenjacke steckte und sie unter seinen linken Oberarm einklemmte. Der Spieler zuckte für einen kurzen Moment zusammen, setzte aber dann sofort ein breites Grinsen auf und zeigte seinem Gegenüber sein blutiges, lückenhaftes Gebiss.
In Casablanca war es längst Tag geworden, als Karl die Bar des Hotels Paris verließ. Zum Abschied hatte er dem grinsenden Spieler noch seine teure goldene Armbanduhr geschenkt, worauf dieser sozusagen als Gegenleistung den beiden farbigen Nutten durch eine stumme Geste befahl, ihre Brüste freizulassen, die ihm, wie er es auch nicht anders erwartet hatte, nicht entgegensprangen, sondern traurig auf den dreckigen Boden starrten.
Durch die verwinkelten Gassen wählte er den kürzesten Weg auf den Boulevard, den er nur in Richtung Norden entlang zu gehen brauchte, um in sein Hotel zu gelangen.
Karl fühlte sich erleichtert, so ganz ohne Ehering und goldene Armbanduhr, ein Geschenk seiner Frau anlässlich seines zweiten Bucherfolges.
Sie hat mir immer Geschenke gemacht, wenn ich Erfolg gehabt habe, dachte Karl. Was für ein Blödsinn! Im Grunde sogar eine Beleidigung, mir wie einem Dressurpferd nach gelungenem fehlerfreien Ritt einen Zucker zu geben. Beim Einzug ins Haus, da hätte sie mir was schenken sollen, aber da war sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Selbst als ich eine Zeit lang keinen Handgriff bis auf das Kochen im Haushalt getan habe, hat sie nicht die Ruhe verloren, sondern einfach eine Haushälterin eingestellt. Wirkliche Probleme hatte es für Marion ja nie gegeben.
Karl zündete sich eine Zigarette an, die er aus der Pappschachtel nahm, die ihm der Spieler mit dem blutigen und lückenhaften Gebiss geschenkt hatte. Schon der erste Zug schmeckte süßlich und erinnerte ihn an seine Studienzeit, wo er mit Bekannten Joints geraucht hatte. Wenn Karl zweifelte, brachte Marion ihr Beispiel von der Notoperation, wo man auch keine Sekunde zögern dürfe, ginge es doch um ein Menschenleben. Zweifel waren für sie reine Zeitverschwendung, etwas, das nicht vorkommen durfte.
Ich fliege, dachte Karl und zündete sich an der süßlich schmeckenden Zigarette, die jetzt nur noch ein Stummel war, eine neue an.
Ich fliege, dabei lachte er und kotzte anschließend die vergangene Nacht auf den am Morgen frisch gereinigten Trottoir aus.
2.
Zur selben Zeit beerdigte man in einem kleinen Bergdorf den vierunddreißigjährigen Bauern Rainer Leutgeb, der sich Tage zuvor mit seinem neuen Sportwagen, da er eine Kurve falsch eingeschätzt und hundertzwanzig Stundenkilometer für angemessen hielt, zu Tode gefahren hatte.
Dem Sarg folgte neben seiner Frau und den zwei kleinen Kindern fast das ganze Dorf, darunter auch der Bürgermeister Pauly mit seiner hübschen Frau Gabrietta, die ihr rechtes Bein nachzog. Es war schon etwas besonderes, dass der Bürgermeister an einer Einsegnung teilnahm. Er galt als viel beschäftigter Mann, aber der Verstorbene war ein Mitglied des Trachtenvereins gewesen, dessen Jugendgruppe er vor Jahren geleitet hatte. Vor fünf Jahren war Pauly das erste Mal zum Bürgermeister der Marktgemeinde St. Johann gewählt worden. Immerhin hatte er es in dieser kurzen Zeit geschafft, in dieser strukturschwachen Gegend die Arbeitslosigkeit drastisch abzubauen.
Bei den Beileidsbekundigungen am offenen Grab schien es Gabrietta, als würde ihr Mann unter seiner auf Seriosität bedachten Politikermaske lächeln. Zu gut kannte sie ihn, als dass er ihr etwas verheimlichen konnte. Sie hingegen hatte viele Geheimnisse und Sehnsüchte, von denen ihr Mann nichts wusste. In ihrer Handtasche verbarg sie eine Postkarte, die den Leutgeb Hof zeigte. Darüber hatte sie in der letzten Nacht mit Kugelschreiber ein großes Kreuz gemalt. Ihr Herz pochte schneller bei dem Gedanken, gleich bevor man das Gasthaus betreten würde, um den Leichenschmaus
einzunehmen, ihrem Mann gegenüber eine Ausrede zu erfinden, um heimlich den Postkasten aufzusuchen, der neben dem Trafikladen hing, damit die Karte, die das Leutgebsche Anwesen und das mit Kugelschreiber gemalte Kreuz zeigte, ihren Weg ging. Es war bereits die neunte Postkarte, die sie so, ohne dass jemand etwas davon wusste, nach Beendigung der Einsegnung und vor dem Leichenschmaus in den Postkasten einwerfen würde. Unheimlich war ihr nur, dass ihr bis heute niemand geantwortet hatte.
So ging Gabrietta, das rechte Bein nachziehend, nachdem die Trauergemeinde in den großen Gasthof neben der Tankstelle eingefallen war, sich immer wieder umschauend in Richtung Trafikladen. Es machte ihr sichtlich Mühe, sich mit der Unterschenkelprothese fortzubewegen. Zuhause auf ihrem großen Hof trug sie nie eine Prothese, sondern behalf sich mit einer Krücke. Gabrietta liebte Kleider, die ihr gesundes Bein sowie das bis zu dem Knie amputierte rechte bloß legten. Sie empfand es als lächerlich, dass ihr Mann bei offiziellen Anlässen darauf bestand, dass sie ihre Prothese anlegte, die schmerzte und durch die sie sich erst als Krüppel fühlte, wo doch das ganze Dorf wusste, was ihr vor über zwanzig Jahren widerfahren war.
Vor dem Trafikladen schaute sie sich nach beiden Seiten um, aber die Hauptstraße war menschenleer. Sie öffnete ihre Handtasche und steckte die Postkarte in den Schlitz. Erleichtert schlug Gabrietta anschließend den Weg in Richtung Gasthof ein. Die Freude, ihrem Mann eine Nasenlänge voraus zu sein, überwog den Schmerz, den ihr die Prothese bereitete.
Sie hatte ihren eigenen Kopf, die Gabrietta, einziges Kind des Großbauern Waltner. Das stattliche Gehöft mit den umliegenden Feldern, Wiesen und der gesamte Viehbestand wurde nach ihrer Hochzeit ihrem Mann überschrieben. Die große Forstwirtschaft aber, wozu auch die beiden imposanten Berge gehörten, die das Tal nach Westen hin abschlossen, blieb in ihrem alleinigen Besitz. Die Leute im Tal und in der Umgebung nannten die beiden Berge Kleinwaltner und Großwaltner.
Die Familie Waltner genoß im Tal und ganz besonders in der Marktgemeinde St. Johann hohes Ansehen. Gabriettas Urgroßvater hatte beispielsweise die einzige Straße, die das Tal durchschnitt, auf eigene Kosten bauen lassen. Auch das kleine Wasserkraftwerk unterhalb des Großwaltners war durch ihn entstanden und bescherte dem Tal schon sehr früh die Bequemlichkeit und Vorteile der Elektrizität. Der Großvater vollendete den Plan, auch von der Westseite her eine Verbindung mit den Nachbargemeinden zu schaffen und baute die Passstraße über den Großwaltner.
Hätte Pauly sie, Gabrietta Waltner, nicht geheiratet, wäre er niemals Bürgermeister der Marktgemeinde St. Johann geworden, das wusste sie.
Als Gabrietta den großen Saal des Gasthauses betrat, war die Luft schon stickig. Die Trauernden saßen an in Hufeisenform angeordneten Tischen und schlürften ihre Suppe. Fast synchron hoben sie die Löffel und führten sie ihren fettigen Mündern zu. Nur die Witwe, gleich alt wie Gabrietta, saß unbeweglich da und starrte ins Leere. Gabrietta kannte Irene Leutgeb von Kindheit an. Gemeinsam besuchten sie die Volks- und später auch die
Hauswirtschaftsschule nahe der Landeshauptstadt. Oft waren beide im Sommer zum Schwarzsee hinausgefahren, hatten sich im hohen Gras nach einem Bad im eiskalten Wasser ihre Träume erzählt. Seit dem fünfzehnten Lebensjahr war Irene in ihren Rainer verliebt gewesen, ein hochgewachsener Junge mit flachsblonden Haaren, der immer lachte und guter Dinge war.
Gabrietta hatte sich keinen Meter nach vorne bewegt, sondern war in der Eingangstür zum großen Saal stehen geblieben. Ihr Mann war inzwischen aufgestanden und hielt eine Rede, während zwei Kellnerinnen die Suppenteller abräumten. Gabrietta hörte nicht zu, sondern versuchte Paulys Augen zu erfassen. Da stand er, bewegte seine Arme geschickt, wählte den richtigen Tonfall, so wie er es im Rhetorikkurs seiner Partei gelernt hatte.
Er ist ein Trommler, dachte Gabrietta, einer, der den Takt vorgibt, und die anderen sind die Ruderer seiner Galeere, unwissend, wohin die Fahrt geht.
Sie schnappte nach Luft, atmete immer schneller.
Dann fiel Gabrietta in Ohnmacht.
Jetzt stand Martin schon zwei Stunden auf der Brennerautobahn Richtung Italien im Stau. Ihn ärgerte es überhaupt hier zu sein. Nächtelang hatte er mit seiner Freundin Inge, die neben ihm saß und mit dem Finger auf der Karte die Strecke abfuhr, über die Notwendigkeit, und zwar grundsätzlich diskutiert, ob es in der heutigen Zeit noch zu verantworten sei, mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Eine Radtour beispielsweise die Donau entlang, hätte es für Martin auch getan. Aber nein, dieses Jahr ließ sich Inge
einfach nicht umstimmen, und als ihre Argumente immer unsinniger wurden, willigte er ein. Wenn er sich vorstellte, dass über 6,3 Millionen Autos über eine Million Lastwagen, hundertdreißigtausend Busse und rund hunderttausend Motorräder jedes Jahr diesen Weg wählten, auf dem er sich seit zwei Stunden im Stau befand, konnte es einem schon schlecht werden. Irgendwo da unten im Tal floss die Eisack, dort war auch die alte Holzbrücke, die nach Klausen führte und die man von unzähligen Bildern her kannte. Zweitausendvierhundert Einwohner mussten den Gestank, den vierundzwanzig Millionen Reisende jährlich verursachten, ertragen.
Vor fast einem Jahr war Martin das letzte Mal hier gewesen und hatte mit einer Schar von Umweltschützern für ein paar Stunden den Verkehr lahmgelegt. Noch nie war ihm so viel Hass entgegengebracht worden wie bei dieser Aktion. Wäre die Polizei nicht anwesend gewesen, hätte es sicher Tote gegeben.
Inge hatte sich zurückgelehnt und die Augen geschlossen, wahrscheinlich träumte sie schon von der Adria und der Ferienwohnung, die sie für drei Wochen angemietet hatten.
In Martins Jackentasche steckte ein ungeöffneter Brief vom Unterrichtsministerium. Es ging um seine erste Anstellung als Lehrer. Er wusste genau, dass man ihn in die Provinz schicken würde. Die Gegend konnte für ihn nicht abgelegen genug sein. Schon während seines Studiums war er überall angeeckt, hatte sich stark politisch engagiert, was vor allem von den Professoren nicht gerne gesehen wurde. Ein Lehrer hatte gegenüber dem Staat loyal zu sein. Das war die oberste Maxime. Martin war jetzt Anfang dreißig und konnte
im Grunde froh darüber sein, überhaupt eine Anstellung bekommen zu haben. Er hatte keine Angst davor, aufs Land zu ziehen. Er liebte die Berge, die Wälder und Wiesen, selbst die oft grobschlächtig wirkenden Menschen gefielen ihm. Inge würde nicht mit ihm mitkommen, dafür liebte sie zu sehr die Stadt. Vielleicht hatte er ja auch deshalb so schnell nachgegeben und der Reise an die Adria zugestimmt. Inge für immer zu verlieren, bereitete ihm Kopfzerbrechen, wie das Gefühl, das ihn manchmal beschlich, doch erwachsen geworden zu sein. Inge war durch und durch ein Stadtmensch. Sie brauchte diese fremdbestimmte Unterhaltung und Zerstreuung, die nur die Großstadt ihr bieten konnte. Das Hupen der Autos, die Abgase, das hektische Treiben auf den Boulevards, die Überflutung mit Angeboten, das tägliche Ringen, sich entscheiden zu müssen, ob ins Theater oder doch lieber ins Kino, auch war man eine Ewigkeit nicht mehr tanzen gewesen, Schlittschuhlaufen wäre auch ganz schön, nein, dann doch lieber Tennis, ein neuer Spanier hat aufgemacht, aber der Italiener an der Ecke ist doch immer noch der beste, ich hätte auch mal wieder Hunger auf ein richtiges Schnitzel, auch der Araber soll nicht schlecht sein, all das brauchte Inge.
Martin indes war mit seinem Kaffeehaus und dem kleinen Eckbeisl mit wechselndem Mittags- und Abendtisch vollkommen zufrieden. Auch wollte Inge nachts noch durch die Kneipen ziehen, da auf ein Bier, da auf einen Wein, hier ein Küsschen und zu guter Letzt noch in eine Bar auf einen Absacker. Martin schien es, wenn er ihr schweigend durch die Szenelokale folgte, als würde sie Hof halten in einer Stadt, die nie zur Ruhe kam, als würde die Stadt eine riesige
Fete feiern, Tag für Tag Silvester zelebrieren, denn bei aller Euphorie, die er in den Lokalen erlebte, glaubte er diesen sehnsuchtsvollen Blick auf den Gesichtern zu spüren. Endzeitstimmung hatte er es einmal genannt. Nicht umsonst hatten diese In-Läden das Ambiente von Wartesälen übernommen. wenn Martin tagsüber seine Stadt beging, etwas was er sehr gern machte, nahm er sehr bewusst die Verwandlung wahr. Alte Häuserzeilen mussten klotzigen Marmorpalästen weichen, gleichzeitig nahm die Zahl der Menschen zu, die ihre Habe in Plastiktüten mit sich herumschleppten. Auch sah er jetzt immer häufiger großräumige Polizeiautos, die diese Menschen von Parkbänken einsammelten, um sie, wie er durch die Linke Zeitung erfahren hatte, an den Stadtrand zu bringen.
»Kommen’s, kommen’s meine Herrschaften«, hörte er einmal später einen Polizisten rufen,»jetzt geht’s zur Stadtranderholung!«
Der Zynismus stirbt in dieser Stadt wohl nie aus, dachte Martin und sah wieder die Schwarz-Weiß-Fotografien vor sich, auf denen alte Männer und Frauen unter den Blicken höhnisch lachender Passanten Gehsteige wischen mussten.
Warum löse ich jetzt nicht einfach den Sicherheitsgurt und steige aus, fragte sich Martin natürlich nicht wirklich, nicht ernsthaft, denn er liebte diese Frau, die neben ihm saß und ohne die er sich ein Leben nicht vorstellen wollte. Drei Wochen Urlaub standen bevor, drei Wochen, in denen er versuchen würde, die Augen vor der Zukunft zu verschließen.
Martin schaute zu Inge herüber, er wusste nicht, ob sie schlief. Martin liebte es, sie so zu beobachten. In unzähligen
Skizzen und Zeichnungen hatte er versucht, ihren Zauber zu ergründen. Ihr gefielen diese Bilder. Martin hingegen hätte sie am liebsten allesamt zerrissen, zu unvollkommen erschienen sie ihm.
Jens Zöller war am Mittag schon mit Kopfschmerzen aufgewacht. Der Föhn hatte mal wieder die Stadt heimgesucht. Zum Glück würde er heute noch abreisen, hinausfahren aufs Land, die Provinznester abklappern mit seinem roten Sportwagen. Jedes Feuerwehrfest, jede Kirchweih, kein Festzelt würde er auslassen, auf der Suche nach immer neuen Talenten. Vorsichtig stieg Jens die Wendeltreppe nach unten, sein Kopf schmerzte bei jeder Stufe. Er schaltete die Kaffeemaschine ein und tapste ins Bad. Eine kalte Dusche würde ihm bestimmt guttun.
Eine Frauenhand hatte mit Lippenstift eine Telefonnummer auf den großen Badezimmerspiegel geschrieben.
Wie im Film, dachte Jens, verzog ein wenig grinsend sein Gesicht, stieg in die Kabine und drehte die Dusche auf. Das kalte Wasser linderte die Kopfschmerzen und nach einer Weile begann er, gegen das Getöse der Brause an zu singen.
Jens liebte Musik. Auf Musik konnte er sich stets verlassen. Sein Gespür für Trends hatte ihm immerhin schon ein kleines Vermögen eingebracht. Seit sechs Jahren schon hatte er Erfolg. Von einem Tag auf den anderen hatte er seine Popgruppen, die er managte und die ihm zudem nur Scherereien und dadurch Kopfschmerzen und ein höllisches Sodbrennen bereiteten, fallen gelassen. Er hätte sich ohnehin nicht länger dieses pubertäre Gedudel anhören können. Vor
allem die Betroffenheitslyriker, die auch noch glaubten, singen zu müssen, raubten ihm den letzten Nerv. Zum Glück wollten immer weniger Menschen diese Musik hören, geschweige denn kaufen.
Jens hatte sich damals einfach ins Auto gesetzt und war die Vororte abgefahren. Drei Besuche in Festzelten reichten aus, um die erste volkstümliche Gruppe zu verpflichten. Eine Single wurde aufgenommen und die Gruppe in den einschlägigen Unterhaltungssendungen platziert. Eine volkstümliche Musikgruppe folgte der anderen. Das Geschäft blühte, vor allem Kinder waren der absolute Renner. Mehrere Dutzend volkstümliche Gruppen hatte er seitdem unter Vertrag. Sein Büro musste er erweitern und Personal einstellen.
Jens drehte die Dusche ab und stieg aus der Kabine. Mit dem großen Badetuch rieb er sich seinen Körper trocken und warf es dann achtlos auf den Boden. Wenn er in zwei Wochen wiederkommen würde, hätte seine Reinemachefrau auch die mit Lippenstift geschriebene Telefonnummer auf dem großen Badezimmerspiegel entfernt.
Das Leben konnte ein einziger Werbespot sein, man muss nur darin zu leben wissen, dachte Jens.
Nackt stieg er die Wendeltreppe nach oben in sein Schlafzimmer. Er stellte die umgekippte Champagnerflasche auf das Tischchen, nahm den gebrauchten Kondom und ließ ihn in die Flasche plumpsen. Jetzt, wo die Folgen des Föhns für einen Moment von ihm gewichen waren, ließ er seine Fantasie schweifen. Da waren die in ihren engen schwarzen Röcken und weißen Blusen bedienenden Kellnerinnen, die Gesundheitsschuhe trugen, die Fesseln eng mit einem
Leinenriemen umschlossen, was er ganz besonders erotisch fand, sowie die Dirndlträgerinnen mit ihrem gerafften Busen und dem einladenden Ausschnitt. Die Landgasthöfe ließen dem Betrachter gegenüber den Bedienungen viel Platz für Fantasie, und da er den Erfolgreichen aus der Stadt verkörperte, brauchte es nicht viele Argumente nach Dienstschluss.
Er packte seine sieben Sachen in den großen Samsonite, verstaute die Kamera in seinem Aluaktenkoffer, steckte sich die Sonnenbrille in sein Haar und verließ die Wohnung. Die Spiegelreflexkamera hatte ihm schon oft gute Dienste erwiesen. Bei Kellnerinnen oder anderem Hauspersonal wirkte es oft Wunder, wenn er nebenbei erwähnte, dass er auch Modelle für die Modebranche suchte und wie der Zufall es so wollte, er zufällig eine Kamera dabei hätte. Für Jens gab es kaum etwas Schöneres, als diese Mädchen langsam von ihren Dienstkleidern zu befreien.
Unten auf der Straße nahm er die gebührenpflichtige Verwarnung, die zwischen Windschutzscheibe und Scheibenwischer steckte, formte sie zu einer Kugel zusammen und schmiss sie pfeifend in die Gosse.